„Ausgewildert“ werden eigentlich Tierarten, die in der freien Wildbahn nicht überlebt haben. Es gibt sie meist nur noch in kleinen, isolierten Biotopen oder sogar nur noch im Zoo. Deshalb müssen auszuwildernde Tiere erst wieder lernen, sich in Freiheit artgemäß zu verhalten, für sich selbst zu sorgen und ihre Rolle in ihrem angestammten Ökosystem einzunehmen. Genau das steht der Christenheit des Westens bevor. Sie hat seit langem in einem goldenen Käfig gelebt: als anerkannte gesellschaftliche Institution, die zeitweise sogar nach der Dominanz in Europa gegriffen hat.

Aber diesen Status verliert das Christentum bei uns gerade. 2022 war das Jahr, in dem in Deutschland erstmals weniger als 50% der Bevölkerung einer Kirche angehörten. Das muss keine Katastrophe sein, aber es läuft auf eine fundamentale Veränderung unserer vertrauten Art des Kircheseins zu.
Im goldenen Käfig
Das Leben im goldenen Käfig hatte für die Kirchen Vorteile. Sie waren in ihrem Bestand geschützt, mussten keine Wagnisse eingehen und waren weniger abhängig vom Wehen des Geistes. Dadurch aber auch abgetrennt von der Welt, eingesperrt in einen religiösen Sonderbereich, ohne echte Erfahrung mit der vollen Realität. Dabei hatte Jesus seine Leute als „Salz der Erde“ mitten in die Welt hinein gesandt – damit sie dort etwas bewirken. Das Salz gibt dem Teig die Würze und konserviert Speisen. Aber nach und nach hat das Salz offenbar seine Kraft verloren – wovor schon Jesus warnte. Die Jesusbewegung, die einmal eine so radikale wie reale Alternative zur vermachteten Welt der Imperien bot, wurde angepasst an die Logik der Gesellschaft. Ihr kritisches Potential wurde gezähmt, und was davon noch übrig blieb, in die religiöse Sphäre abgeschoben. Damit war es aus seinem eigentlichen Ökosystem vertrieben: der realen Welt mit ihren Kämpfen und Konflikten, ihrer Schönheit wie ihrer Entstellung.
Das ist dem Christentum nicht gut bekommen. Es wurde zwar zeitweise zur dominierenden Religion der Gesellschaft, verlor gerade dadurch aber viel von seiner Glaubwürdigkeit und Kraft. Es lebte nicht mehr von der geistlichen Vollmacht der Jüngerinnen und Jünger Jesu, sondern von seiner gesellschaftlichen Position. Im Augenblick erleben wir, wie wenig geistliche Substanz in der Christenheit des Westens übrig bleibt, wenn der Status als religiöse Agentur der Gesellschaft verloren geht.
Domestizierte Theologie
Aber nicht nur organisatorisch ist die Jesusbewegung domestiziert worden. Auch ihre Theologie und ihre Organisationskultur sind nicht mehr auf die Auseinandersetzung mit der Welt der Macht, der Konflikte und der kleinen wie großen Katastrophen vorbereitet. Sie versuchen nicht, eine Alternative dazu zu realisieren, sondern bemühen sich um Plausibilität und Akzeptanz in der Welt, wie sie nun einmal ist. Sie sind konfliktscheu geworden.
Dabei brauchen wir gerade jetzt eine deutliche Alternative zu den wachstumsgeprägten Idealen des Kapitalismus. Ein Wirtschaftssystem, das in einer begrenzten Welt unbegrenztes Wachstum anstrebt, gefährdet – wie wir doch wohl alle längst wissen – auf die Dauer das Überleben der Menschheit. Aber bei den Kämpfen um eine alternative, schöpfungsfreundlichere Lebensart steht die Kirche seltsam unbeteiligt daneben und verfasst höchstens ausgewogene Presseerklärungen.
Dabei ist es innerkirchlich ziemlich unbestritten, dass wir nicht weiter so mit der Schöpfung umgehen dürfen. Auch glühende Anhänger des Neoliberalismus sind hier relativ selten. Es ist eher so, dass die innere Logik der Institution es nicht vorsieht, dass man sich in solche Auseinandersetzungen einbringt. Als Einzelpersonen tun das viele, aber die Religionsorganisation Kirche steht in einer anderen Ecke. Da geht es um das Seelenheil der Einzelnen, egal, ob man das nun eher jenseitig oder diesseitig verortet (das hängt von der individuellen Theologie ab).
Natürlich hat es immer Ausnahmen gegeben. Nie ließ sich das Evangelium ganz hinter die Kirchenmauern verbannen. Immer wieder inspirierte es Einzelne dazu, mehr zu tun als nur die Regeln der Institution zu befolgen. Und es hat tatsächlich einiges beigetragen zur Zivilisierung der Gesellschaft. Oft auch, indem es Menschen inspirierte, die sich eher nicht kirchlich oder christlich verstanden. Christlich verankerte Werte wie die Menschenwürde fanden ihren Weg auch in säkulare Zusammenhänge. Aber im ganzen war die christliche Alternative keine Alternative zur gesellschaftlichen (Un)Ordnung mehr. Und sie wollte es auch nicht mehr sein.
Auf der Suche nach einem anderen Typ von Kirche
Diese Kirche scheint nun langsam an ihr Ende zu kommen. Kaum jemand redet noch im Brustton der Überzeugung von der „Volkskirche“. Etwas Altes geht zu Ende, aber es ist noch nicht klar, was nun an Neuem kommen könnte. Viele Reformvorschläge laufen auf alten Wein in neuen Schläuchen hinaus: die alten Inhalte, das alte Kirchesein, aber in neuen Strukturen, neuen Stilen, moderner, lebendiger, internetgestützt sowieso und immer am Puls der Zeit. Sollte das wirklich schon reichen?
Kirche auszuwildern bedeutet dagegen, das Evangelium aus der babylonischen Gefangenschaft in den Selbstverständlichkeiten der institutionalisierten Kirche zu befreien. Das betrifft zunächst einmal die Theologie und – in deren Folge – die kirchliche Organisationskultur. Denn natürlich ist das kirchliche Binnenklima von theologischen Mustern geprägt. Aber das heißt nicht, dass sie deshalb schon gut wären. Im Gegenteil.
Nur ein Beispiel: die kirchliche Konfliktscheu und Ausgewogenheit ist ja letztlich vom Wunsch motiviert, niemandem (vor allem nicht sich selbst) weh zu tun. Eigentlich durchaus ein christliches Motiv. Nur dass Jesus manchmal sehr konfliktbetont auftrat, ist da nicht im Blick. Aber auch das war Liebe, nur ist das in der kirchlichen Mentalität noch nicht angekommen.
Das Problem liegt tiefer als gedacht
Auf solchen tief verankerten Grundentscheidungen und Werten sind unsere Institutionen erbaut, die staatlichen ebenso wie die kirchlichen. Und man kann Institutionen nur verändern, wenn man ihre inneren Werte versteht und auch sie weiterentwickelt. Deshalb sollten alle Diskussionen zu einer Kirche von Übermorgen fundamental ansetzen: bei einer Revision der theologischen Basics tief unten im Maschinenraum. Schließlich betrifft der Schwund christlicher Substanz so ziemlich alle Konfessionsfamilien. Dann scheint das Problem aber nicht in konfessionellen oder individuellen Spezialitäten zu liegen, sondern gerade in dem, was all diese Fraktionen des Christentums verbindet.
Aber das ist gerade das Problem, dass sich die gegenwärtige Form des Christentums als so alternativlos präsentiert, dass auch die Kritiker nicht über diesen Rahmen hinaus denken UND sich auch nichts davon versprechen, es zu tun. Aber es ist gerade diese Systemlogik hinter unserer Art Kirche zu sein, die viele gutgemeinte Ansätze daran hinter, ihr volles Potential zu entfalten.
Wir müssen unsere Aufmerksamkeit also auf das richten, was völlig selbstverständlich zum Christentum zu gehören scheint. Das wahrzunehmen ist für Kirchenleute ähnlich schwierig, wie es für Fische sein muss, das Wasser wahrzunehmen. Um so lohnender ist es aber, wenn wir unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was selten thematisiert und noch seltener in Frage gestellt wird: Gebäude etwa. Oder die Wege der Finanzierung und die Verteilung dieser Ressourcen. Die Gottesdienste (und, nein, es geht nicht um „lebendigere“ Gottesdienst und auch nicht um Musikstile) und Gruppen. Die deklarierten und die wahren Ziele der Organisation. Ihr Sitz im Leben. Und einen Haufen ähnlicher Themen.
Auch wenn man es nicht mehr merkt: hinter all dem stehen Wertentscheidungen, also letztlich Theologie, auch wenn das meistens kaum noch zu erkennen ist. Und daraus ist der goldene Käfig erwachsen, der die Christ:innen immer wieder davon abhält, ihre Rolle in ihrem natürlich Ökosystem einzunehmen: in der vollen Breite der Realität mit all ihren Höhen und Tiefen, Scheußlichkeiten und Schönheiten.
Worum es hier geht
Auf dieser Webseite werden – ergänzend zum Buch – nach und nach Beiträge zu verschiedenen Facetten dieses Themas erscheinen. Leider gibt es keinen einzelnen Angelpunkt, von dem man sich versprechen könnte, dass sich alles zum Besseren wenden würde, wenn man dort ansetzt.
Und natürlich gibt es das auch als Buch, in dem vieles ausführlicher und im großen Zusammenhang dargestellt wird:
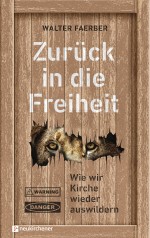
Zurück in die Freiheit
Wie wir Kirche wieder auswildern
von Walter Faerber
208 Seiten
1. Auflage
24,00 €